InhaltsangabeZu dieser Untersuchung.- A: Die ‚angemessene Erwerbstätigkeit‘ in Gesetz und Rechtsprechung.- I. Die ‚Angemessenheitsklausel‘.- 1. Zur Reform des Ehegattenunterhalts.- 2. Die ‚angemessene Erwerbstätigkeit‘, § 1573 Abs. 1 in Verb. mit § 1573 Abs. 2 BGB.- 3. Gründe für die Einführung der ‚Angemessenheitsklausel‘ und Einwände dagegen.- 4. Die fiktive Gleichwertigkeit von Haus- und Berufsarbeit.- 5. Die Leistungen der Hausfrau und ihre beruflichen Nachteile.- 6. Das Verhältnis von strukturellen und ehebedingten Nachteilen.- 7. Die Umwandlung von ehelichen Lebensverhältnissen in Berufstätigkeit.- II. Zur Geschichte der Erwerbspflicht im Scheidungsunterhaltsrecht.- 1. Die ‚Üblichkeitsklausel‘.- 2. Die ‚Zumutbarkeitsklausel‘.- 3. Die Reformbemühungen.- 4. Ergebnis: ‚Angemessenheit‘.- III. Hilfsmittel des Richters und parallele Rechtsgebiete.- 1. Die juristischen Kommentare.- 2. Die juristische Aufsatzliteratur.- 3. Das Schadensrecht des BGB.- 4. Der Zumutbarkeitsbegriff im Sozialversicherungsrecht.- IV. Tendenzen der Rechtsprechung zur Angemessenheitsklausel.- 1. Zur Quellenlage.- 2. Begriffliche Schwierigkeiten.- 3. Inhaltliche Rückgriffe auf den Zumutbarkeitsbegriff und auf eine sozialrechtliche Betrachtungsweise.- 4. Das Einkommen als Maß aller Dinge.- 5. Gleichwertigkeit von Haus- und Berufsarbeit noch nicht voll anerkannt.- 6. Der Billigkeitsaspekt.- 7. Überwiegend strenge Anforderungen bei der Arbeitssuche.- 8. Teilzeitarbeit als Patentrezept.- 9. Ausdehnung der ehelichen Teilzeitarbeit zur ‚angemessenen‘ Vollzeittätigkeit.- 10. Anrechnung fiktiven Einkommens.- 11. Verschulden durch die Hintertür.- 12. Die kurze Dauer der Ehe.- 13. Das Gericht hilft den Tüchtigen.- 14. Bildungshunger allein reicht nicht.- 15. Der Hausmann.- 16. Zusammenfassung der Rechtsprechungstendenzen.- 17. Einige Gründe für die aufgezeigten Tendenzen.- 18. Verbesserungsvorschläge.- B: Die ‚angemessene Erwerbstätigkeit‘ im Blickwinkel der Soziologie.- I. Die Angemessenheitsklausel als Herausforderung an die angewandte Sozialforschung.- 1. Die gegenwärtige Rechtssituation als Ausgangspunkt einer rechtssoziologischen Analyse.- 2. Die ‚angemessene Erwerbstätigkeit‘ nur ein akademisches Problem oder tatsächlich praxisrelevant?.- 3. Die Angemessenheitsklausel als Thema für die Soziologie.- II. Die methodischen Voraussetzungen und Ansprüche dieser Untersuchung.- 1. Zu den Grenzen und Möglichkeiten der ‚Angemessenheitsstudie‘ als Entscheidungshilfe für die Rechtsprechung zur ‚angemessenen Erwerbstätigkeit‘.- 2. Besondere Schwierigkeiten bei der Beschaffung einschlägiger Informationen.- 3. Die wichtigsten Einschränkungen bei der Interpretation vorliegender Ergebnisse.- III. Die soziologisch-empirische Begründung der Angemessenheitsklausel.- 1. Phasenerwerbstätigkeit und Familienkarrieren im Licht der Berufs- und Sozialstatistik.- 2. Die ‚weibliche Normalbiographie‘. Eine biographische Skizze als Orientierungsraster für die Rechtsprechung.- 3. Weibliche Lebensläufe zwischen Familie und Beruf und männlicher Erwerbskarrieren – eine Gegenüberstellung ‚typischer‘ Männer- und Frauenbiographien.- 4. Änderungen in der Erwerbsdynamik und beim Heiratsverhalten von Frauen. Machen sie die Angemessenheitsklausel auf die Dauer überflüssig?.- 5. Die gescheiterte Hausfrauen-Ehe – ein regulationsbedürftiger Tatbestand für die gegenwärtige und künftige Rechtspraxis. Strukturelle Grenzen und normative Barrieren bei der Anwendung der Angemessenheitsklausel.- IV. Die Angemessenheitsklausel im Lichte verbreiteter Urteilsstereotypen.- V. Die realen Anwendungsbedingungen der gesetzlichen Bestimmungen zur ‚angemessenen Erwerbestätigkeit‘.- 1. In der Rechtsprechung gängige Vermittlungshindernisse.- 2. Typische Hausfrauen-Handicaps.- 3. Strukturell bedingte Grenzen des Arbeitsmarkts.- 4. Verhinderungen und Möglichkeiten.- VI. Fragen der Maßstabsgewichtung.- 1. Der bisherige berufliche Werdegang oder die ehelichen Lebensverhältnisse – was ist wichtiger?.- 2. Welchen Einfluß haben die einzelne







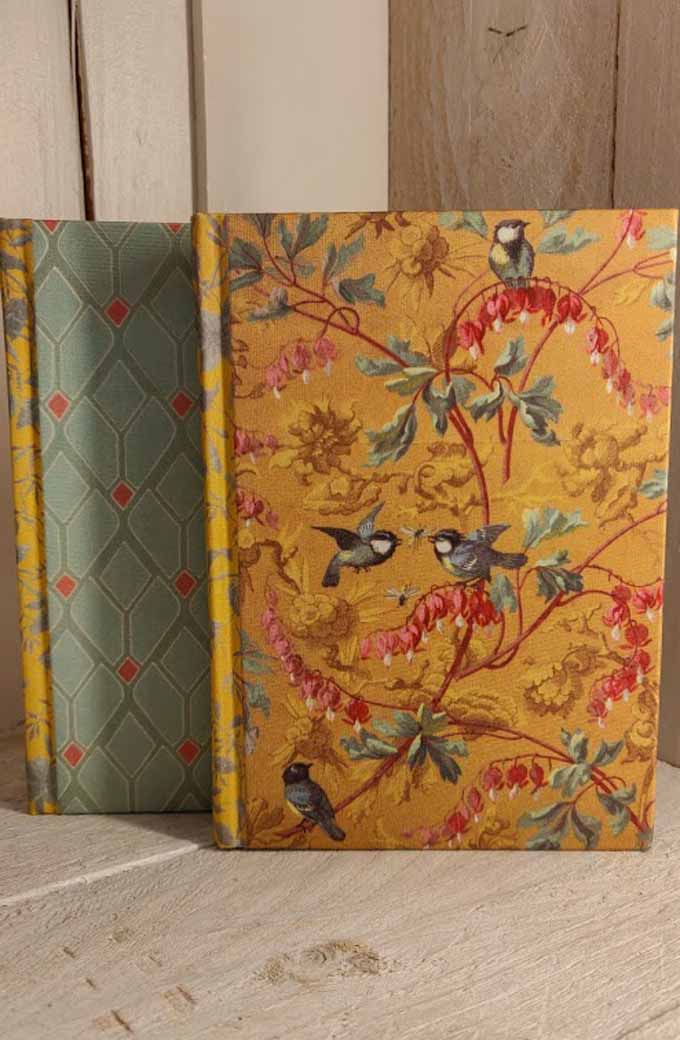

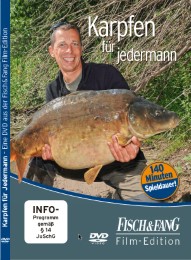




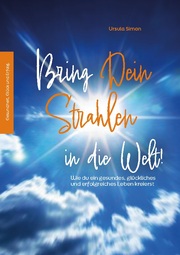

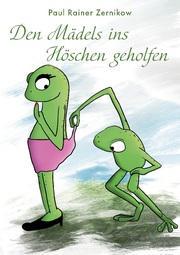









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.