Inhaltsangabe1. Rahmenbedingungen der Datenschutzkonzeption für ein INA.- 1.1 ADV und ärztliche Schweigepflicht.- 1.2 Das Projekt ‚INA‘ – zugleich ein Geleitwort.- 1.2.1 Entstehung und förderungspolitischer Zusammenhang.- 1.2.2 Einige Lehren aus der Projektarbeit.- 1.3 Das Teilprojekt ‚Datenschutzkonzeption für ein INA‘.- 1.3.1 Schwierigkeiten bei der Durchführung.- 1.3.2 Literaturlage.- 1.3.3 Neuheit der Problemstellung.- 1.4 Ziel und Aufbau dieser Studie.- 2. Deskriptive Vorgaben, Der hypothetische Soll-Zustand von INA.- 2.1 Terminologie.- 2.2 Das systemanalytische Beschreibungsverfahren.- 2.3 Hypothetisch-empirische Annahmen im einzelnen.- 2.3.1 INA-Hardware-Konfiguration.- 2.3.2 Datenarten.- 2.3.3 Datenbahnen und -Operationen, Software.- 2.3.4 Informationsorganisation.- 2.3.5 Rechtliche und Kontrollorganisation.- 2.3.6 Umweltrelation: Interessenten und Umsystem.- 3. Normative Vorgaben: Rechtliche Randbedingungen.- 3.1 Ärztliche Schweigepflicht.- 3.1.1 Gesetzliche Grundlagen.- 3.1.2 Umfang und Voraussetzungen der ärztlichen Schweigepflicht.- 3.1.3 Befugnis zur Weitergabe von Informationen, die der Schweigepflicht unterliegen.- 3.1.4 Datenverkehr innerhalb von INA.- 3.1.5 Wissenschaftliche und gesundheitspolitische Auswertung.- 3.1.6 Auskunftsrecht des Patienten.- 3.2 Datenschutzrecht.- 3.2.1 Geltung des BDSG.- 3.2.2 Inhalt des BDSG.- 3.3 Krankenhausgesetze.- 3.4 Ergebnis.- 4. Das System des Datenschutzes.- 4.1 Grundannahmen der bisherigen Datenschutztheorie.- 4.1.1 Komplementarität von Datenschutz und Datenverarbeitung.- 4.1.2 Informationskontrolle und Datenverkehrsrecht.- 4.1.3 Datenschutz als Organisationsproblem.- 4.1.4 Spezifische Leistung von Informationssystemen.- 4.1.5 Das System und seine Umwelt.- 4.2 Unzureichende Lösungsvorschläge.- 4.2.1 ‚Privatsphäre‘.- 4.2.2 ‚Personenbezogene Daten‘.- 4.2.3 ‚Sensitive Daten‘.- 4.2.4 ‚Verrechtlichung‘.- 4.2.5 ‚Einwilligungstheorie‘.- 4.2.6 ‚Entfremdungstheorie‘.- 4.2.7 ‚Kein Datenschutz für Planung und Forschung notwendig‘.- 4.2.8 Datenschutzgesetze.- 4.3 Skizze des Lösungsprinzips.- 4.3.1 Umfassender Schutzbereich.- 4.3.2 Gesamtplanung des Datenschutzes.- 4.3.3 Flankierende Maßnahmen.- 4.3.4 Selbst- und Fremdkontrolle.- 4.3.5 Kontroll- und Abwehrrechte der Betroffenen.- 4.4 Spezielle Datenschutzhypothesen.- 4.4.1 Postulat I der ökonomischen Realisierung.- 4.4.2 Postulat II des Vorrangs der technischen Realisierung.- 4.4.3 Postulat III der möglichst dichten Abschottung.- 4.4.4 Postulat IV der Ausschließung des undichten Dritten.- 4.4.5 Postulat V der definierten Struktur.- 4.4.6 Postulat VI der möglichsten Einfachheit.- 4.4.7 Postulat VII der verteilten Kontrolle.- 4.4.8 Postulat VIII des zusätzlichen Schutzes.- 4.4.9 Postulat IX der Beteiligung der Betroffenen.- 4.4.10 Postulat X des überschaubaren Systems.- 5. Datenschutzkonzept -Realisierungsvorschlag.- 5.1 Vorschläge auf der Ebene der Hardware (einschließlich Betriebssystem).- 5.2 Vorschläge auf der Ebene der Daten.- 5.2.1 Depersonalisierung durch Patientennummer.- 5.2.2 Arztnummer.- 5.2.3 Verschlüsselung.- 5.2.4 Bedingte Aufhebung der Depersonalisierung.- 5.2.5 Manuelle Informationsverarbeitung.- 5.2.6 Spezielle Datenprobleme.- 5.2.7 Auswirkungen dieser Vorschläge.- 5.3 Vorschläge auf der Ebene der Informationsbahnen und -programme.- 5.3.1 Minimierung des manuellen Informationsverkehrs.- 5.3.2 Programmkontrolle.- 5.3.3 Funktionsentmischung von Daten.- 5.4 Vorschläge auf der Ebene der Informationsorganisation.- 5.4.1 Differenzierung von allgemeiner und Informationsorganisation.- 5.4.2 Elemente der Informationsorganisation.- 5.4.3 Datei- und Datenbankorganisation.- 5.4.4 Zugriffs- und Bedienungsberechtigung.- 5.4.5 Drei Ebenen der Verantwortung.- 5.4.6 Folgen der ärztlichen Gesamtverantwortung.- 5.4.7 Kontrollstelle.- 5.5 Vorschläge auf der Ebene der Benutzer.- 5.5.1 Praxis.- 5.5.2 Labor und apparative Zentren.- 5.5.3 Rechenzentrum.- 5.5.4 Das manuelle Teilsystem.- 5.5.5 Patient.- 5.5.6 Sonderfälle.- 5.6 Vorschläge auf der Ebene der Inte


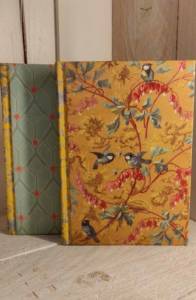




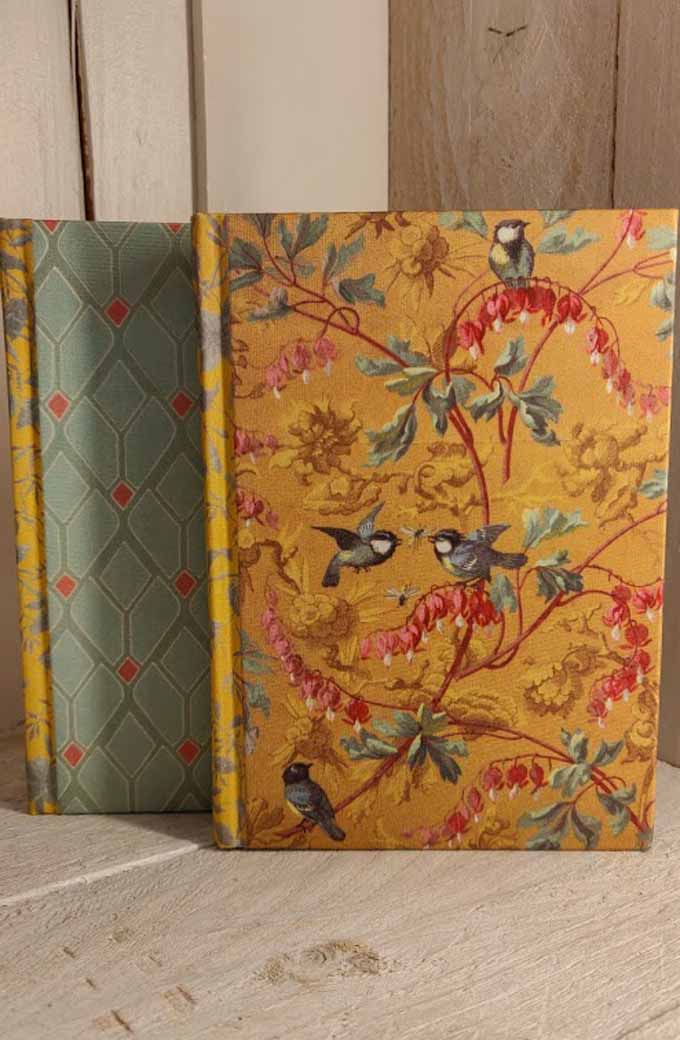






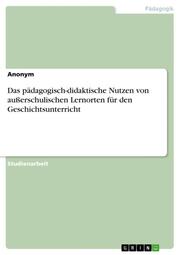


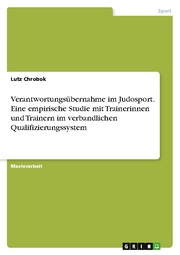
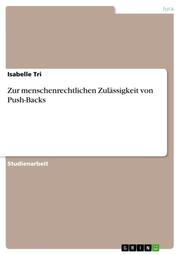







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.