Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Pädagogik – Pädagogische Soziologie, Note: 1,7, Fachhochschule Südwestfalen, Abteilung Iserlohn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Sorge um die Existenz der Familie, die in der heutigen Zeit durch die Krise der Finanzmärkte und damit verbundene Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt hervorgerufen wird (vgl. Jurczyk, 2009, S.14 f.), verlangt nach neuen Wegen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine Umstrukturierung der bisherigen, traditionellen Rollenverhältnisse ist daher unumgänglich. Seit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 ist die Väterbeteiligung bei der Beanspruchung des Elterngeldes von 3,5% (2006) auf 20% (2010) gestiegen (vgl. Statistisches Bundesamt, 2007/2011). Es zeichnet sich seit diesem Zeitpunkt eine neue Vaterrolle in Deutschland ab. Es nehmen immer mehr Männer die Elternzeit in Anspruch und übernehmen Aufgaben, die sonst nur der Frau zugetraut wurden. Wickeln, füttern, zu Bett bringen der Kinder, aber auch Hausarbeiten, wie Putzen, Kochen und Waschen, gehören immer mehr zu den Aufgaben des Mannes. Der Vater hat heute immer weniger die traditionelle Ernährerfunktion und immer mehr die Erzieherfunktion. Der neue Vater ist nicht mehr ausschließlich berufsorientiert, sondern auch familial engagiert. Häusliche Arbeiten werden von ihm mit übernommen und berufliche Arbeitszeiten aus familiären Gründen reduziert. Innerhalb der Gesellschaft ist diese neue Vaterschaft jedoch noch in der Entwicklung. Viele Männer haben sie zwar schon erfolgreich angewandt, jedoch ist auch die traditionelle Vaterrolle in einigen Familien noch von Bedeutung. ‚Es müssen die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Männern eine größere Beteiligung in ihren Familien ermöglicht‘ (Janzen, 2010, S.109). Für junge Männer stellt sich heutzutage die Frage, für welche Form von Vaterschaft sie sich entscheiden: für die







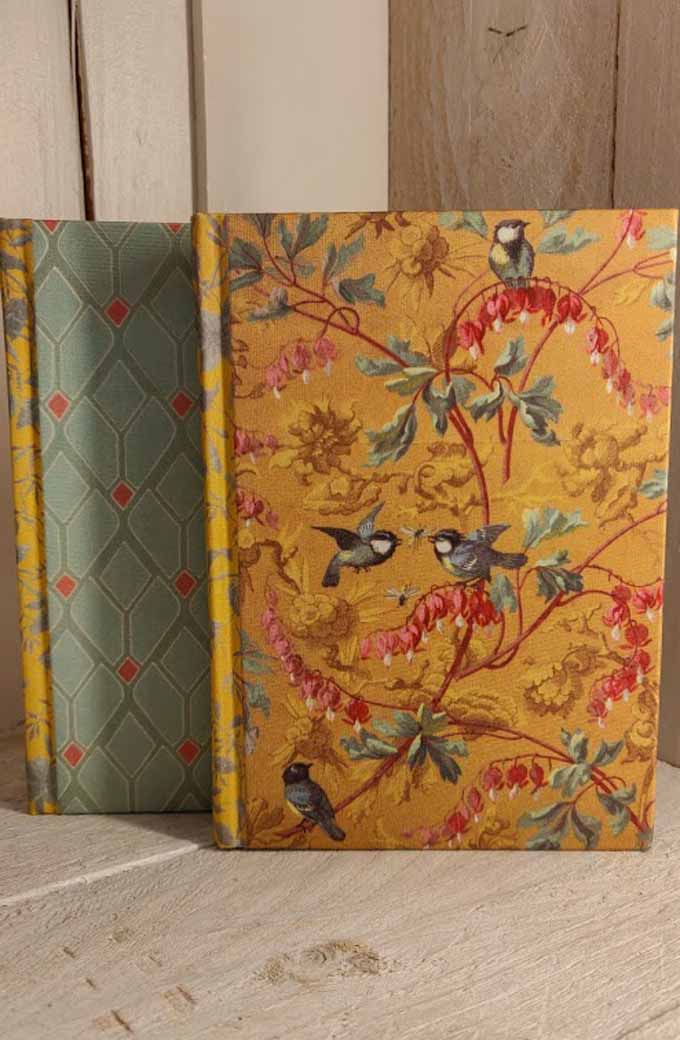


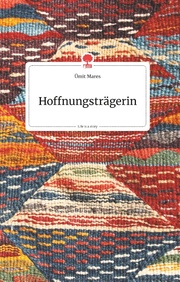




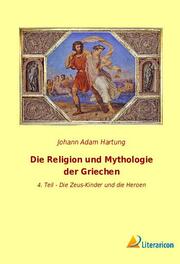
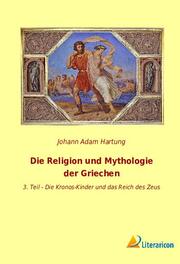
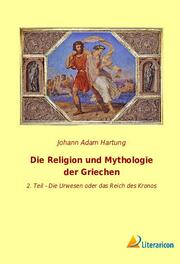
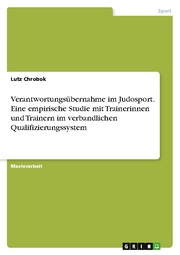







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.